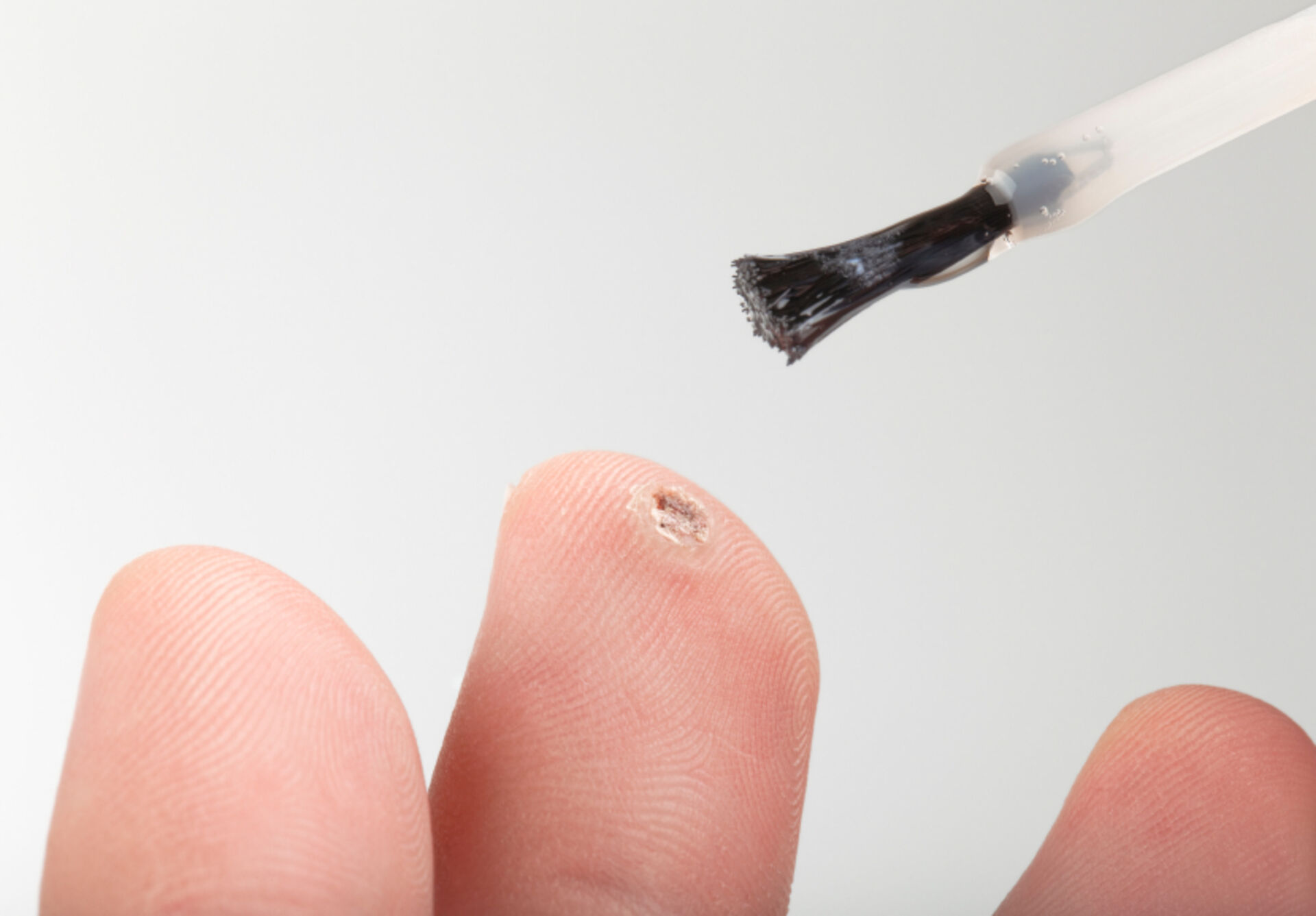Wie konnte aus der ganz persönlichen Angst, das eigene Kind könnte entführt werden, ein Katalog gesellschaftlicher Forderungen und sogar gesetzlicher Bestimmungen werden? Haben nicht auch viele Menschen panische Angst vor dem Fliegen? Trotzdem muss sich niemand öffentlich dafür rechtfertigen, wenn er mit seiner Tochter ein Flugzeug betritt und sie damit der äusserst geringen, aber doch reellen Gefahr eines Absturzes aussetzt.
Brooks hat mit vielen Menschen über diese Fragen geredet und ist dabei auch auf die Psychologin Barbara Sarnecka gestossen. Die Kognitionsforscherin legte in einem Experiment mehr als 1500 Menschen verschiedene Szenarien vor, in denen eine Mutter ihr Kind kurz alleine lässt, und liess sie die Wahrscheinlichkeit beurteilen, dass diesem etwas zustösst. Das Ergebnis: Je moralisch fragwürdiger die Befragten den Grund für die Abwesenheit der Mutter hielten, desto höher schätzten sie das Risiko ein. Holte sich die Mutter einen Kaffee oder traf kurz ihren Lover, brachte sie ihr Kind damit also offenbar in grössere Gefahr, als wenn sie von einem Auto angefahren wurde und das Kind unabsichtlich alleine liess.
Als Sarnecka die Mutter in den Kurztexten durch den Vater ersetzte, fiel ihr noch etwas auf: War der Grund für dessen Abwesenheit ein Geschäftstermin, wähnten die Befragten das Kind offenbar ebenfalls in geringerer Gefahr. Das war aber nicht der Fall, wenn die Mutter beruflich bedingt weg war. Erwerbstätigkeit scheint im Leben eines Vaters unvermeidlich zu sein – in dem der Mutter ist sie es nicht.
«Wir haben uns vielleicht damit abgefunden, dass Mütter auch noch etwas anderes möchten als Muttersein», schreibt Brooks in ihrem Buch «Small Animals». «Aber es gefällt uns nicht.» Einen Vater machen all seine anderen Interessen und Verpflichtungen nicht weniger zum Vater. Eine Mutter, die dasselbe tut, vernachlässigt ihre Kinder.
Was für ein Bild der Welt zeichnen wir ausserdem unseren Kindern, wenn wir ständig Ausschau halten nach den schlimmsten aller schlimmen Fälle? In den Vereinigten Staaten haben in den letzten Jahren Millionen von Schülerinnen und Schülern sogenannte Lockdown Drills durchlaufen, schreibt die Pädagogin Erika Christakis im amerikanischen Magazin «The Atlantic». Trainings, die Kinder auf den furchtbaren, aber extrem seltenen Fall eines Amoklaufs vorbereiten sollen. Dazu gehören: Alarme, die sich erst im Nachhinein als Übung zu erkennen geben, die Aufforderung, im Klassenzimmer Hockeypucks und Dosengerichte aufzubewahren, Sicherheitsanweisungen für Kindergärtner, die sich zur Melodie eines bekannten Einschlafliedes singen lassen.
Ob irgendetwas davon tatsächlich für mehr Sicherheit sorgt, sagt Christakis, sei mehr als unklar. Allein schon deshalb, weil potenzielle Täter den Drill ja allenfalls mitmachen. Doch beschäftigt sie anderes noch mehr: Rechtfertigt der zweifelhafte Nutzen solcher Trainings den seelischen Schaden, den sie möglicherweise anrichten in einem Land, in dem mehr und mehr Kinder an Angststörungen leiden oder sich das Leben nehmen?
Aufwachsen mit Warnungen
Wie vermittelt man Kindern Zuversicht, wenn man ihr Leben fortlaufend mit Warnungen versieht? Woraus soll sich der Glaube speisen, dass die Welt auch viel Gutes bereithält, dass man an ihr wachsen kann?
Dabei braucht es vermutlich gar nicht viel. Ich kann mich noch heute an den Tag erinnern, an dem mein bester Freund und ich zum ersten Mal bis nach Einbruch der Dunkelheit vor dem Haus Frisbee spielen durften. Dem Gefühl von Abenteuer tat es keinerlei Abbruch, dass unsere Mütter stets in Rufweite waren.
Man kann mit dem spätabendlichen Frisbee natürlich nicht ewig zuwarten. Es ist unwahrscheinlich, dass eine 18-Jährige dieselbe Mischung aus Aufregung, Stolz und Übermut dabei verspürt wie eine Achtjährige. Das Gefühl entsteht wohl nur da, wo sich ein genügend bedeutsamer Wunsch und etwas Ungewissheit paaren, und man sich auf dem Weg zu dessen Erfüllung ein wenig strecken, grösser werden muss.